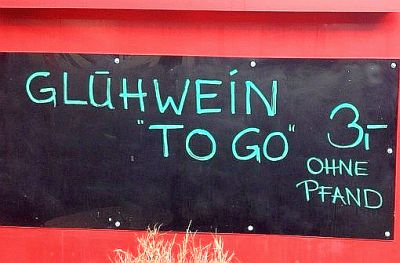|
Während die Wissenschaft
nach wie vor über die Herkunft unseres irdischen Wassers rätselt
(vom Kometen Tschuri jedenfalls, meldeten diese Woche die Nachrichtenagenturen,
komme es nicht), stellt sich mir die Frage, wohin der Glühwein
geht. Die Frage lässt mich nicht mehr los, seit ich an einem
Lokal hinterm Stuttgarter Rathaus ein Schild mit der Aufschrift
„Glühwein to go“ entdeckte.
Das steht
dort wirklich. Ich kann das beweisen, auch wenn ich von Glühweinschwaden,
die vom Stuttgarter Weihnachtsmarkt herüberwehten, schon leicht
benebelt sein mochte. Ein Kollege hat das Schild fotografiert.
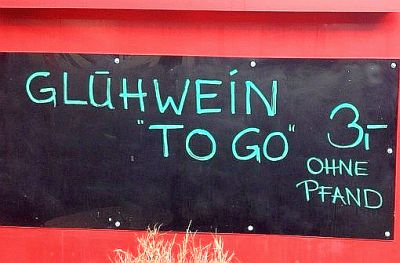
Ich
glaube, in der CSU-Hochburg Bayern ist eine Sprachpanscherei
wie „Glühwein to go“ sowohl im öffentlichen wie auch im privaten
Raum verboten – allein schon, weil dadurch bei Einheimischen
der Eindruck entstehen könnte, der Glühwein käme aus einem westafrikanischen
Land. Es mag zwar Bier auf Hawaii geben, aber Glühwein in Togo?
Der
Glühwein ist und bleibt ein urdeutsches Getränk, das deshalb
erfunden wurde, weil das Verklappen von minderwertigen Weinen
auf hoher See den Fischen nicht bekam. In Binnengewässern war
es von jeher verboten, so dass der Ursprung der Forelle blau
ein anderer sein muss.
Weil der Konsum
von Glühwein gelernt sein will, gegen Ende unserer auch auf
Verbraucherschutz bedachten Kolumne die zwei wichtigsten Regeln
beim Umgang mit dem Heissgetränk:
1.)
Weniger ist im Falle von Glühwein meist mehr. Wer zu viel erwischt,
verstösst gegen eine Energiesparmassnahme der Europäischen Union,
läuft er doch Gefahr, am nächsten Tag mit einer Glühbirne durch
die Gegend zu torkeln.
2.) Niemals
den Tag mit einem Glas Glühwein beginnen. Ist aber eigentlich
auch logisch, sonst hiesse das Frühstück ja Glühstück.
Sollte
Ihnen beim Lesen dieses Textes nicht nach Lachen gewesen sein,
probieren Sie es mit Glühweinen.
|