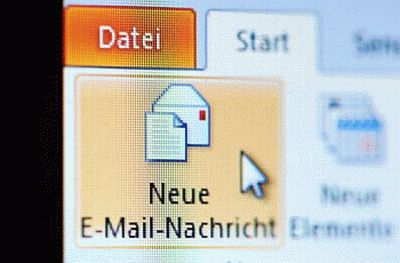|
Stuttgart - Auch die Lebensspanne
des digital vernetzten Menschen ist begrenzt. Das mag der Grund
sein, dass sich derzeit ein im Internet kursierender Verhaltenskodex
für E-Mail-Nutzer grosser Beliebtheit erfreut. Darin steht,
dass ein elektronisch versandter Brief keinesfalls länger als
fünf Sätze sein soll.
Warum gerade
fünf?, fragt man sich als Mensch, der bisher gewohnt war, sein
Leben an zehn Geboten auszurichten. Weil fünf eine Primzahl
ist? Weil zu den Grundlagen des Islam Fünf Säulen gehören? Weil
die Fünf in Österreich die schlechteste Schulnote ist?
Lassen
wir fünfe grade sein und überlegen lieber, was man in fünf Sätzen
so alles sagen kann. Vermutlich allerhand. Nehmen wir nur mal
den Dichter Heinrich von Kleist, wohl einer der wenigen Erdenbürger,
der die Gabe besass, sich in ellenlangen Schachtelsätzen klar
auszudrücken. In fünf Sätze hätte der zur Not seinen „Michael
Kohlhaas“ gepackt.
Vielsprechend in
der Hinsicht dürfte auch der Grieche Solon gewesen sein, der
mal einen Satz schrieb, der über 300 Zeilen ging. Gern hätten
wir für die Generation Twitter ausgerechnet, wie viel das in
Tweets ist, aber leider haben wir keinen Hinweis auf die Zeilenbreite
gefunden.
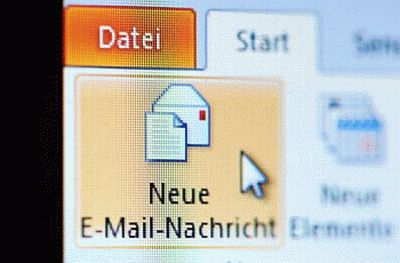
Nicht
schlecht auch der österreichische Schriftsteller Hermann Broch
(1886 bis 1951). Ihm gelang in seinem im amerikanischen Exil
geschriebenen Roman „Der Tod des Vergil“ ein Satz mit 1077 Wörtern.
Selbst wenn wir davon ausgehen, dass darin nicht Bruttolohnumwandlungsberechnung
steht, kommt bei 1077 Wörtern ganz schön was zusammen.
Sie
sehen, man muss nur die richtigen Schreiber ranlassen, dann
können fünf Sätze verdammt viel sein – womöglich gar zu viel.
Was soll nach einem Satz wie „Ich erkläre Dir hiermit den Krieg“
oder „Du bist die grösste Pfeife, die mir jemals begegnet ist“
noch kommen? Jeder weitere Satz würde die Klarheit der Botschaft
verwässern.
Wüssten Sie übrigens, dass
die perfekte Zeitungskolumne 21 Sätze lang ist? Wenn Sie es
nicht glauben, zählen Sie nach.
|