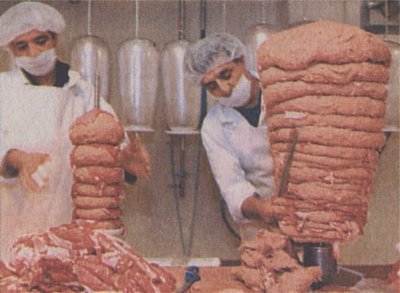Wenn
wir Ihnen, lieber Leser, auf dieser Seite ein besonders ekeliges
Bild unterbreiten würden, etwa die Innenaufnahme einer bulgarischen
Werkskantine oder den Wäschekorb eines Neonazis, würden Sie
Ihrem Ekel gehorchend schnell weiterblättern. Ekel bewahrt uns
durch starken Würgereflex vor Gift und Schmutz. Er ist ein Nebenprodukt
der Evolution, um uuns vor Infektionen zu schützen, kurz: Ekel
hält gesund.
Offenbar ist diese Funktion
im Zuge der menschlichen Entwicklung verloren gegangen. Spätestens
seit EInführung des Privatfernsehens ekeln wir uns vor nichts
mehr. Im Gegenteil: Das Abscheuliche zieht uns an. Die
amerikanische Lehrerin Sylvia Branzei nützt das für ihren Unterricht
aus und führte das Schulfach Grossology , also Ekelkunde ein.
"Beim Zehennägelschneiden zu Hause wunderte ich mich, was
das schwarze Zeug unter den Rändern wohl sei. Und ich hatte
die Idee, solche unappetitlichen Dinge könnten doch auch meine
Schüler interessieren", erzählte sie einem Wissenschaftsmagazin.
Unsere
Redaktion blickt stets kritisch auf das Schwarze unter den
Zehennägeln von Politik und Gesellschaft. Bis heute aber
wissen wir nicht, aus welchen Substanzen sich dieser Dreck zusammensetzt.
Ein ähnliches Problem hatten diese Woche die Beamten der bayrischen
Sonderkommission "Kühlhaus". SIe stellten Tonnen von
altem Dönerfleisch sicher, das zur Weiterverarbeitung in ganz
Deutschland bestimmt war. Nun ist Dönerfleisch (siehe Bild)
bereits im Urzustand das Schwarze unter den Fingernägeln der
Lebensmittelbranche. Sein Nährwert wird allerdings unterschätzt.
Unsere Wissenschaftsredaktion fand nähmlich in einigen der gerösteten
Bomben neben Zigaretten, Autoreifen und Maschinenöl auch Reste
von Fleisch.
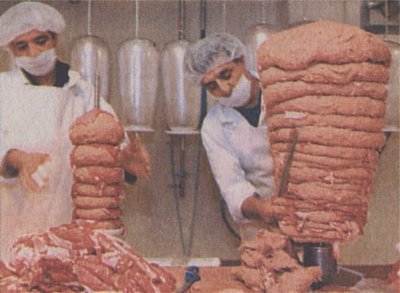
Grossologen
interpretieren die Anziehungskraft des Döners auf junge
Esser mit der Darreichung. Die voluptuöse Form und die ausgestrahlte
Wärme erinnern Kinder an die Geborgenheit im Mutterleib. Das
stoische Drehen des Spiesses beruhigt Stadtneurotiker, das Herabfallen
dünner Fleischschnipsel schafft die Atmosphäre eines Winternachmittags.
Ekel
ist also relativ. Jean Paul Sartre beschrieb das in seinem
Roman "Ekel", dessen Protagonist von der eigenen Existenz
angewidert ist. Er dreht sich selbst und schwitzt vor Abscheu.
Womit sich der Kreis zum Döner wieder schliesst. |