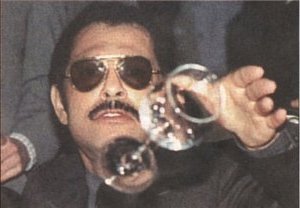Reihenweise
wurden in dieser Woche so genannte Machtwörter gesprochen.
Kanzler Schröder verbot seiner Partei, den Bundespräsidenten
ins Dickicht niederer Parteitaktik und Vulgarität zu zerren.
Er untersagte damit alles, was in der Politik noch Spass macht.
Oben im Norden war es wenige Tage später der Veteran der Hamburger
Zuhälterszene, Karl Heinz Schwensen (siehe Bild), der es sich
verbat, immer noch als Negerkalle tituliert zu werden.
Schliesslich sprach sich noch der Papst gegen die Homo-Ehe und
das ganze andere unappetitliche Zeugs aus.
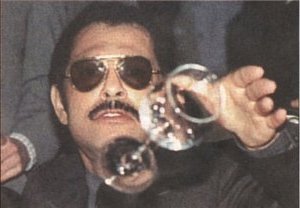
Die
Wirkung dieser Machtwörter liess indes zu wünschen übrig:
Dem Kanzler streckten seine Parteilinken die Zunge raus, Negerkalle
musste zur Kenntnis nehmen, dass niemand mehr von ihm Kenntnis
nehmen will, und der Papst fand nur noch in jenen altkatholischen
Gegenden Gehör, zu denen Schwulen im Zuge der Drittstaatenregelung
die Einreise ohnehin verwehrt wird.
Unsere
Wissenschaftsredaktion zieht daraus einen Schluss: Ein Machtwort
ist kein Ausdruck von Macht, sondern signalisiert deren
Abwesenheit. Im Zuge der Globalisierung haben weder abgewirtschaftete
Politiker, noch Kriminelle oder Päpste viel zu sagen. Die Macht
liegt in den Händen der Wirtschaft. Der Beweis wurde ebenfalls
diese Woche geliefert: Ein Siemens-Chef muss nur zerstreut das
Wort "Geschenk" während seiner Sitzung zu seinen Abteilungsleitern
murmeln, schon wird am nächsten Tag die ganze Handy-Produktion
bunt eingepackt und in den fernen Osten geschickt.
Wer
sein Terrain gesichert und arrondiert hat, muss auf das
fragwürdige Instrument des Machthwortes nicht zurückgreifen.
Von Angelika Merkel hat man deshalb noch nie ein öffentliches
Machtwort gehört. Es reicht, wenn sie unbotmässigen Parteifreunden
ein Handyfoto ihren mecklenburgischen Seenplatte schickt, auf
der sie nach Feierabend die Köpfe poltischer Gegner servieren
lässt. Ob die noch die Zunge herausstrecken, spielt dann überhaupt
keine Rolle mehr. |